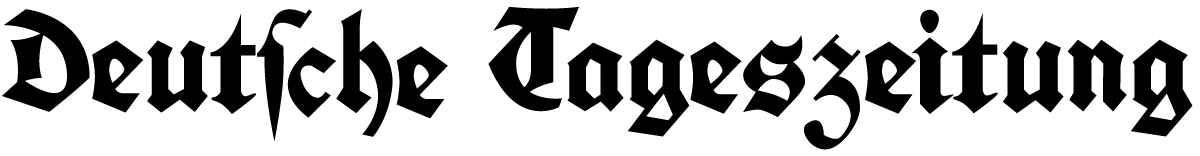Glyphosat-Verbot in Österreich kann nicht im Januar in Kraft treten

Das im Sommer vom Parlament beschlossene Glyphosat-Verbot in Österreich kann nicht wie geplant im Januar in Kraft treten. Grund sei ein "Formfehler", teilte Regierungschefin Brigitte Bierlein (parteilos) in einem Brief an den Parlamentspräsidenten mit. Der Gesetzentwurf sei der EU nicht zur Notifizierung übersandt worden. Für ein Glyphosat-Verbot sei dies aber "zwingend" vorgeschrieben, damit die EU und andere Mitgliedstaaten Stellung nehmen können.
"Ich darf betonen, dass es sich ausschließlich um eine formaljuristische Entscheidung und nicht um eine inhaltliche Wertung der Novelle handelt", schrieb Bierlein. Im Nationalrat in Wien hatte die SPÖ das Verbot mit den Stimmen der rechtspopulistischen FPÖ und der grün ausgerichteten Liste Jetzt im Juli durch das Parlament gebracht. Die konservative ÖVP stimmte gegen das Vorhaben. Die Europäische Kommission beanstandete die fehlende Notifizierung bis Ablauf der Frist am 29. November bereits.
In der Europäischen Union ist Glyphosat noch bis 2022 zugelassen. Das österreichische Parlament hatte in seinem Beschluss auf das Vorsorgeprinzip verwiesen, wonach auch Substanzen verboten werden dürfen, wenn deren Gefährlichkeit nicht zweifelsfrei bewiesen wurde.
Das Umweltministerium in Wien hatte laut Nachrichtenagentur APA aber schon vor der inhaltlichen Rechtsunsicherheit gewarnt. Ein nationaler Alleingang sei nur möglich, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorgelegt werden, die bei der EU-weiten Zulassung von Glyphosat 2017 nicht bekannt waren, oder wenn Österreich spezielle Probleme etwa für Umwelt oder Gesundheit nachweisen könne, die es nur dort, aber in keinem anderen EU-Staat gebe. Beides liege nicht vor.
Glyphosat, das zu den am weitesten verbreiteten Pflanzenschutzmitteln der Welt gehört, steht im Verdacht, Krebs zu erregen. In der Forschung ist das aber umstritten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stufte es 2015 als "wahrscheinlich krebserregend" ein. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) sieht hingegen kein Krebsrisiko.
(Y.Ignatiev--DTZ)