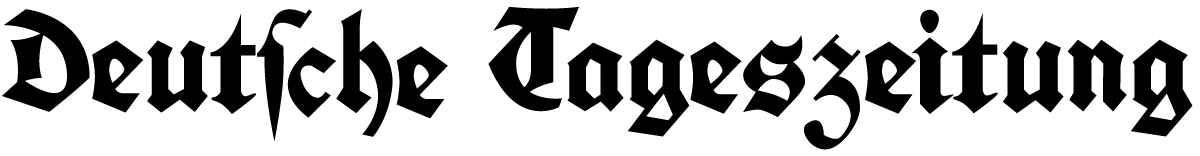Europas neue Trägerrakete Ariane-6 startet erfolgreich ins All

Die europäische Raumfahrt hat wieder einen eigenständigen Zugang zum Weltraum: Nach langjähriger Vorbereitung ist Europas neue Trägerrakete am Dienstag erfolgreich ins All gestartet. Die Ariane-6 hob um 16.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) von Kourou in Französisch-Guayana zu ihrem Jungfernflug ab, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann, sprach von einem "wichtigen und essentiellen Meilenstein".
Die Rakete soll künftig für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber Satelliten ins All befördern. Bei ihrem ersten Start, der wegen eines "kleinen Problems" am Boden um eine Stunde verschoben werden musste, hatte die neue Trägerrakete knapp 20 "Passagiere" an Bord: Mikrosatelliten von Universitäten und wissenschaftliche Experimente, darunter auch einige aus Deutschland.
Wie die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) mitteilte, wurden die Mikrosatelliten eine Stunde und sechs Minuten nach dem Start erfolgreich im Orbit abgesetzt. ESA-Chef Josef Aschbacher sprach von einem "historischen Tag für die ESA und für Europa".
Freude über den erfolgreichen Start gab es auch in Berlin bei der Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt. Der Start sei "ein starkes Zeichen für ein souveränes und innovatives Europa", erklärte Christmann. Sie sprach zudem von einem "unglaublich wichtigen und essentiellen Meilenstein für die zukünftige Ausgestaltung der europäischen Raumfahrt".
Walther Pelzer, Mitglied des Vorstands des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, sprach ebenfalls von einem großen Erfolg. Der Chef der US-Weltraumbehörde Nasa, Bill Nelson, schrieb im Onlinedienst X von einem "Riesensprung nach vorn" für die ESA.
Das Vorgängermodell Ariane-5 war nach 27 Jahren im Einsatz im Juni vergangenen Jahres zum letzten Mal gestartet. Seitdem konnten die Europäer nicht mehr eigenständig Satelliten in die Umlaufbahn bringen: Seit Moskaus Invasion in der Ukraine haben sie keinen Zugang mehr zur russischen Trägerrakete Sojus, die zehn Jahre lang von Französisch-Guayana aus gestartet war. Die Verzögerung des eigentlich für 2020 geplanten Jungfernflugs der Ariane-6 verschärfte die Krise.
Das Projekt Ariane-6 war 2014 beschlossen worden und kostete 4,5 Milliarden Euro. Deutschland ist nach Frankreich der zweitgrößte Beitragszahler des Ariane-6-Programms der Esa.
Ariane-6 wird Satelliten in einige hundert Kilometer Höhe bringen, aber auch in eine geostationäre Umlaufbahn in 36.000 Kilometern Höhe. In dieser Höhe entspricht die Geschwindigkeit des Satelliten der Rotationsgeschwindigkeit der Erde, sodass Beobachter am Boden den Eindruck haben, er würde sich nicht bewegen. Das Vinci-Triebwerk der Rakete kann wiederholt gezündet werden, um mehrere Satelliten an verschiedenen Punkten im All absetzen zu können.
Der erste kommerzielle Flug von Ariane-6 soll Ende des Jahres stattfinden, 14 weitere sind in den folgenden zwei Jahren geplant. In der ersten Phase sind neun Flüge pro Jahr geplant. Damit ist Ariane weit entfernt vom US-Unternehmen SpaceX, das den Wettbewerb dominiert und allein im Mai 14 Starts der Rakete Falcon 9 absolvierte.
Das Weltraumgeschäft boomt. Bis 2032 werden laut dem Beratungsunternehmen Novaspace 822 Milliarden Dollar (767 Milliarden Euro) für Trägerraketen, Satelliten und andere Teile der Raumfahrtindustrie ausgegeben werden. Vergangenes Jahr waren es noch 508 Milliarden Dollar.
Doch auch die wachsende Nachfrage reicht nicht, um Ariane-6 rentabel zu machen. Bisher sind nur die ersten 15 Flüge finanziert. Die 22 Esa-Mitgliedstaaten erklärten sich aber bereit, bis zu 340 Millionen Euro jährlich zuzuschießen, um den 16. bis 42. Flug der Ariane-6 zu sichern – im Gegenzug für elf Prozent Preisnachlass seitens der Industrie.
30 Aufträge hat Ariane-6 schon, allein 18 von Amazon, um Satelliten für sein Großprojekt Kuiper für satellitengestützte Internetverbindungen ins All zu bringen.
(L.Møller--DTZ)