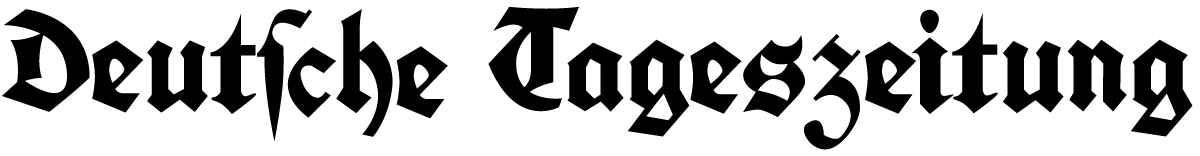Tausende erinnern inmitten von Rassismus-Debatte an Sklaverei-Abschaffung

Inmitten der anhaltenden Proteste gegen Rassismus sind tausende Menschen in den USA auf die Straße gegangen, um an das Ende der Sklaverei vor 155 Jahren zu erinnern. Von New York bis Los Angeles fanden am Freitag, dem inoffiziellen Gedenktag "Juneteenth", Demonstrationen, gemeinsame Gebete und Feste statt. In Washington stürzten Demonstranten die einzige Statue eines Konföderierten-Generals in der Stadt. Trump richtete derweil vor seiner ersten Massenkundgebung seit Beginn der Corona-Krise eine scharfe Warnung an potenzielle Teilnehmer von Protesten in Tusla.
In Washington versammelten sich Menschen vor dem Lincoln Memorial und in der Nähe des Weißen Hauses. Auf Fernsehbildern war am späten Abend zu sehen, wie die Statue von Albert Pike mit Seilen von seinem Sockel gerissen und in Brand gesetzt wird. Dazu skandierten dutzende Menschen den Slogan der Anti-Rassismus-Bewegung "Black lives matter".
Trump verurteilte den Sturz der Statue und griff zugleich die Washingtoner Polizei an. "Die Polizei kommt ihrer Aufgabe nicht nach. Sie sieht zu, wie eine Statue gestürzt und abgefackelt wird", schrieb er im Internetdienst Twitter. Die Demonstranten sollten "sofort festgenommen" werden. "Eine Schande für unser Land."
Die Aktion ereignete sich am Rande von Protestmärschen im ganzen Land zur Erinnerung an das Ende der Sklaverei vor 155 Jahren. Diese fanden inmitten der anhaltenden Proteste gegen Rassismus statt. Die Diskussion um das Erbe der Sklaverei hat durch die Anti-Rassismus-Proteste an Brisanz gewonnen. Im Zuge dieser Proteste waren in den vergangenen Tagen in verschiedenen Städten bereits mehrere Statuen von Führungsfiguren der Südstaaten umgestürzt worden.
"Juneteenth" istein Schachtelwort aus den englischen Wörtern für Juni und 19: Am 19. Juni 1865 hatte ein General der Unionstruppen in Galveston im Bundesstaat Texas die Freilassung aller Sklaven verkündet. 155 Jahre später ist die Debatte um die Verbrechen jener Zeit wieder aktuell. Seit Wochen gehen hunderttausende Menschen auf die Straße, um gegen systematischen Rassismus und Ungerechtigkeit zu protestieren.
Die Proteste waren durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ausgelöst worden. Sie wurden zuletzt durch die Tötung eines weiteren Schwarzen durch die Polizei in Atlanta weiter angefacht.
In New York marschierten mehrere tausend Demonstranten friedlich durch die Straßen. Sie riefen die Namen der Afroamerikaner, die in den vergangenen Jahren von der Polizei getötet wurden. "Dieses Jahr hat das ganze Land eine Abrechnung erlebt", sagte die 38-jährige Demonstrantin Tabatha Bernard. Sie unterstützte die wachsenden Forderungen, den 19. Juni zum Nationalfeiertag zu erklären. "Es liegt an uns, das so lange fortzusetzen, bis wir eine Veränderung erreicht haben."
Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden erinnerte die US-Bürger daran, "dass unser Land zu schlimmster Gewalt und Ungerechtigkeit fähig ist, aber auch eine unglaubliche Fähigkeit besitzt, neu geboren zu werden".
Trump seinerseits erklärte: "An diesem 19. Juni verpflichten wir uns, als eine Nation unseren höchsten Idealen treu zu leben und immer auf ein freieres, stärkeres Land hinzuarbeiten, das die Würde und das grenzenlose Potenzial aller Amerikaner schätzt."
Trump will am Samstag in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma seine erste Wahlkampfkundgebung seit Lockerung der Corona-Restriktionen abhalten - ausgerechnet an jenem Ort, an dem ein weißer Mob 1921 bis zu 300 Schwarze tötete. Kritiker sehen in der Orts- und Terminwahl für Trumps Auftritt eine gezielte Provokation.
Ursprünglich hatte der Präsident sogar am "Juneteenth" in Tulsa auftreten wollen, kurzfristig wurde die Veranstaltung dann um einen Tag verschoben. Der Wahlkampfauftritt ist ohnehin umstritten, da sich der Präsident über Bedenken hinwegsetzt, die Veranstaltung mit zehntausenden Trump-Anhängern könnte die Ausbreitung des Coronavirus befördern.
Trump warnte am Freitag im Onlinedienst Twitter seine Gegner davor, für Proteste nach Tulsa zu reisen. "Alle Demonstranten, Anarchisten, Unruhestifter, Plünderer oder Gesindel, die nach Oklahoma kommen, bitte begreift, dass ihr nicht wie in New York, Seattle oder Minneapolis behandelt werdet", schrieb er. Dem Präsidenten wird vorgeworfen, die zuletzt verschärfte gesellschaftliche Auseinandersetzung um Rassismus und Diskriminierung angeheizt zu haben.
(V.Sørensen--DTZ)